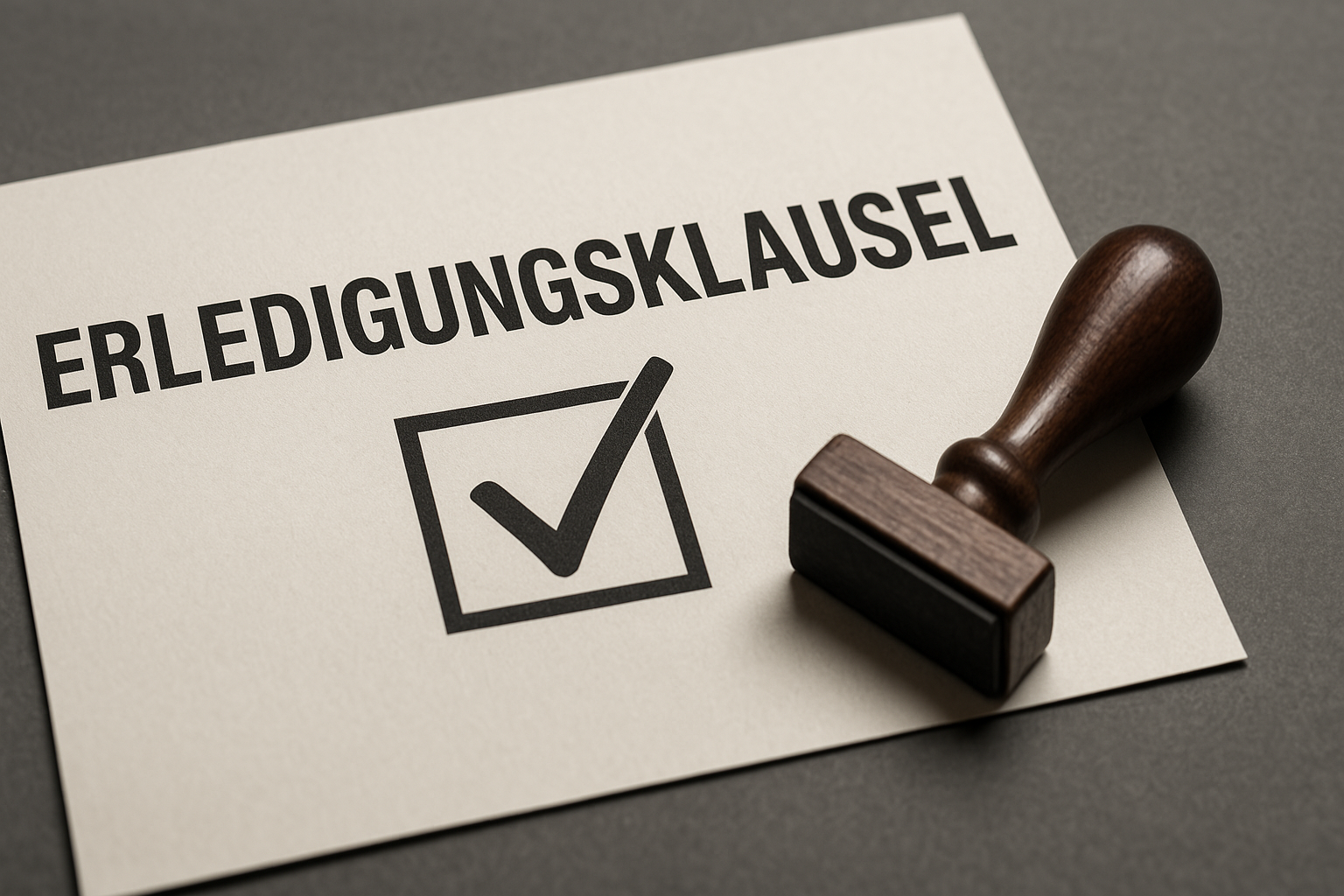Warum die Formulierung juristischer „Schlussstriche“ im Arbeitsverhältnis besondere Sorgfalt verlangt – und was eine aktuelle Entscheidung ausgerechnet des Bundesgerichtshofs (BGH) damit zu tun hat.
Wenn es um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen geht, endet ein sehr großer Teil der arbeitsgerichtlichen Verfahren durch Vergleich. Häufig kommt es auch ohne vorherige gerichtliche Auseinandersetzung zu einer Beendigung durch einen außergerichtlichen Aufhebungsvertrag. Fast immer enthalten diese Einigungen sogenannte Erledigungsklauseln (bei vollständiger Erledigung häufig auch „Generalquittung“ genannt).
Ziel ist es, sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis abschließend zu regeln und künftige Streitigkeiten auszuschließen. Doch dieses Ziel wird nicht immer erreicht, wie eine aktuelle Entscheidung des – für „normale“ arbeitsrechtliche Streitigkeiten nicht zuständigen – BGH zeigt. Dieser hatte über Ansprüche eines ehemaligen Arbeitnehmers nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNErfG) zu entscheiden, dessen Arbeitsverhältnis durch einen Vergleich mit einer Erledigungsklausel vor dem Arbeitsgericht beendet worden war (BGH, Urt. v. 12.11.2024 – X ZR 37/22).
Aber fangen wir ganz vorne an:
Was ist eine Erledigungsklausel?
Erledigungsklauseln – auch Abwicklungsklauseln genannt – sind Regelungen, mit denen die Parteien übereinkommen, dass durch den Abschluss des gerichtlichen Vergleichs oder eines Aufhebungsvertrags eine endgültige Regelung aller Rechte aus der zu beendenden Vertragsbeziehung gezogen werden soll und – abgesehen von Ansprüchen, die darin ausdrücklich geregelt werden – wechselseitig keine Ansprüche irgendwelcher Art mehr bestehen sollen. Häufig findet sich eine Formulierung wie:
„Mit Erfüllung dieser Vereinbarung sind sämtliche gegenseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und seiner Beendigung erledigt, gleich welcher Art und gleichgültig, ob bekannt oder unbekannt.“
Insbesondere für Arbeitgeber hat dies eine zentrale Funktion: Sie wollen vermeiden, nachträglich mit weiteren finanziellen Forderungen konfrontiert zu werden – etwa zu Überstundenvergütung, Boni, Urlaub oder variablem Gehalt.
Nicht alle Ansprüche lassen sich pauschal „erledigen“
Bereits hier liegt ein juristisches Minenfeld: Nicht auf alle Ansprüche kann wirksam verzichtet werden, selbst wenn dies in einer Erledigungsklausel so formuliert ist. Bestimmte Rechte sind gesetzlich unverzichtbar. Dazu zählen insbesondere:
- Ansprüche nach dem Mindestlohngesetz (§ 3 MiLoG)
- Tarifvertragliche Ansprüche (§ 4 Abs. 3 TVG)
- Rechte aus Betriebsvereinbarungen (§ 77 BetrVG)
- Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB)
- Zum Teil auch Rechte aus dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG)
Solche Regelungen dürfen nicht durch vertragliche Vereinbarungen unterlaufen werden. Versuchen es die Parteien dennoch (etwa durch eine zu weit gefasste Erledigungsklausel), droht die Unwirksamkeit der gesamten Klausel (§ 307 Abs. 1 BGB i.V.m. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB). Denn eine pauschale Ausschließung, die auch nicht verzichtbare Rechte einschließt, stellt regelmäßig eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers dar. Dieser ist im Arbeitsverhältnis nach ständiger Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) im Zusammenhang mit der Begründung oder Beendigung von abhängigen Arbeitsverhältnissen grundsätzlich als Verbraucher i.S.d. § 13 BGB anzusehen, da er diese Vereinbarungen regelmäßig weder im Zusammenhang mit einer gewerblichen noch mit einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit schließt.
BGH: Keine Erledigung ohne gemeinsame Vorstellung vom zu erledigenden Anspruch
Das Problem mit den unverzichtbaren Ansprüchen in Ausschluß- oder Abgeltungsklauseln ist nicht neu und in der arbeitsgerichtlichen sowie der fachanwaltlichen Praxis seit längerer Zeit bekannt. Es wird daher inzwischen auch nicht mehr so häufig übersehen.
Die Entscheidung des BGH vom 12. November 2024 bringt aber noch einen zusätzlichen, rechtlich anders gelagerten Aspekt ins Spiel – und eine klare Warnung für die Praxis. Hierbei geht es nicht um die grundsätzliche Unverzichtbarkeit eines Anspruchs, sondern darum, ob die Klausel als solche überhaupt den fraglichen Anspruch erfasst.
Der Fall: Nach einer betriebsbedingten Kündigung schlossen Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen gerichtlichen Vergleich, inklusive einer weitgehenden Erledigungsklausel. Später machte der Arbeitnehmer eine Erfindervergütung geltend (§§ 9 ff. ArbnErfG) und klagte letztlich erfolgreich.
Der BGH stellte fest: Die Klausel sei nicht geeignet, diesen Anspruch auszuschließen. Entscheidend sei, ob die Parteien bei Abschluss der Vereinbarung mit einem solchen Anspruch überhaupt gerechnet hatten oder rechnen mussten. Eine „Erledigung ins Blaue hinein“ sei unzulässig.
Damit verbietet sich unter dem Gesichtspunkt des sichersten Weges in diesem Zusammenhang künftig die unveränderte Beibehaltung pauschaler und allumfassender Formulierungen wie „gleichgültig, ob bekannt oder unbekannt“ o.ä.
Und zwar konsequenterweise auch unabhängig davon, ob es tatsächlich Ansprüche gibt, die von den Parteien „übersehen“ werden konnten. Denn eine Formulierung, die entgegen der BGH-Rechtsprechung grundsätzlich auch unbekannte Ansprüche einbeziehen will, gefährdet dann vorhersehbar die Wirksamkeit der Erledigungsklausel als solcher.
Nach Ansicht der Richter kann eine wirksame Erledigungsklausel nur solche Ansprüche erfassen, die die Parteien in ihre rechtliche und tatsächliche Bewertung bei Vertragsschluss einbezogen haben oder vernünftigerweise hätten einbeziehen müssen:
„Die vereinbarte Abgeltungsklausel bezieht sich ihrem Wortlaut nach auf sämtliche Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und dessen Beendigung. Wie schon das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, sind die im vorliegenden Rechtsstreit geltend gemachten Ansprüche auf Arbeitnehmervergütung davon jedenfalls deshalb nicht erfasst, weil keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass die Parteien im Rahmen ihrer Auseinandersetzung vor dem Arbeitsgericht auch eine Regelung über diese Ansprüche treffen wollten.“
(BGH, Urteil vom 12.11.2024 – X ZR 37/22, Rn. 21)
Da über eine mögliche Erfindervergütung vor Vergleichsschluß nicht einmal gesprochen worden war und dieser Anspruch nach Ansicht des BGH auch nur eher „lose“ mit dem Arbeitsverhältnis verbunden ist, war die Klausel im Ergebnis wirkungslos.
Alternative: Der Tatsachenvergleich
Ein gangbarer Weg, auch potenziell unverzichtbare oder strittige Ansprüche wirksam zu regeln, ist der sogenannte Tatsachenvergleich (§ 779 BGB). Dabei einigen sich die Parteien nicht auf einen Verzicht, sondern auf das Bestehen oder Nichtbestehen bestimmter Tatsachen – etwa, wie viele Urlaubstage offen sind oder ob eine Zielvereinbarung erfüllt wurde.
Voraussetzung ist, dass über die fragliche Tatsache tatsächlich Uneinigkeit bestand. Ein Tatsachenvergleich setzt also ebenfalls voraus, dass die Möglichkeit eines Anspruchs erkannt wurde – andernfalls handelt es sich erneut um einen unzulässigen „Blankoverzicht“.
Ausschlussklauseln in Arbeitsverträgen – auch kein Allheilmittel
Viele Arbeitsverträge enthalten sogenannte Ausschlussklauseln, die regeln, dass Ansprüche binnen einer bestimmten Frist (z. B. drei Monate) geltend gemacht werden müssen – sonst verfallen sie. Doch auch hier gilt: Unverzichtbare Rechte dürfen nicht erfasst werden. Eine Ausschlussklausel, die z. B. den Anspruch auf Mindestlohn nicht ausdrücklich ausnimmt, ist insgesamt unwirksam (vgl. BAG, Urt. v. 18.9.2018 – 9 AZR 162/18).
Fazit: „Das haben wir immer schon so gemacht“ kann riskant sein!
- Erledigungsklauseln sollten sorgfältig und insbesondere vor Gericht auch unabhängig von persönlichen Vorlieben und gängigen „Diktiertraditionen“ des jeweiligen Arbeitsgerichts formuliert werden. Auch Arbeitsrichter(innen) nehmen gerne das zu Protokoll, was sie kennen und gewohnheitsmäßig immer vorschlagen.
- Unverzichtbare Rechte sind stets ausdrücklich von der Regelung auszunehmen.
- Wo möglich und sinnvoll, kann die Formulierung eines konkreten Tatsachenvergleichs mehr Rechtssicherheit bieten.